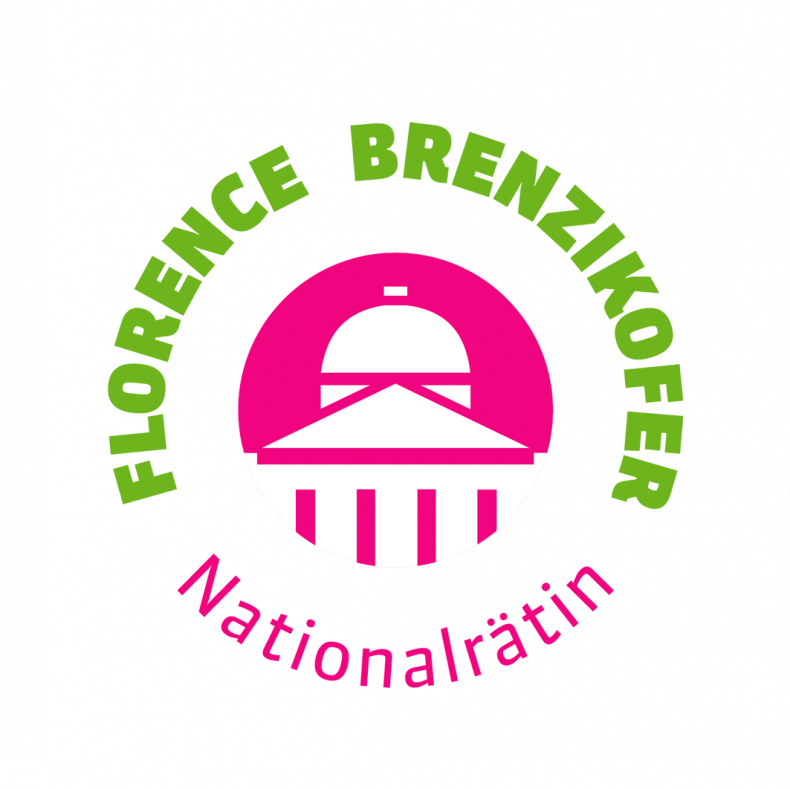Interpellation: AKW-Neubauverbot – keine Unsicherheiten in der Energiepolitik schaffen
- Auf welcher fundierten, wissenschaftlichen und technologischen Analyse basiert die Entscheidung, das AKW-Neubauverbot aufzuheben, obwohl neue Kerntechnologien noch nicht marktreif sind? Oder plant der Bundesrat den Bau von Kraftwerken mit konventioneller AKW-Technologie?
- Wie soll der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden, wenn gleichzeitig ein Gegenvorschlag verfolgt wird, der Investitionsklima und Planungssicherheit in diesem Bereich zu beeinträchtigen droht?
- Inwiefern trägt der Bau neuer Atomkraftwerke tatsächlich zur Versorgungssicherheit und zur Erreichung der Klimaziele bei, angesichts der langen Bauzeiten und der Inflexibilität der Technologie?
- Wie gedenkt der Bundesrat, die massiv höheren Kosten und finanziellen Risiken, die mit neuen AKW-Projekten verbunden sind, zu bewältigen, ohne dadurch die Förderung der erneuerbaren Energien zu gefährden?
- Wie lässt sich die Genehmigung des Neubaus von Atomkraftwerken in einer kleinen, dicht besiedelten und potenziell verwundbaren Schweiz mit den bekannten Risiken dieser Technologie vereinbaren?
- Welche Strategien verfolgt der Bundesrat, um die Abhängigkeit von ausländischer Atomtechnologie und den damit verbundenen geopolitischen Risiken, insbesondere im Hinblick auf Lieferketten und Ressourcen aus autokratischen Staaten (zB. Uran aus Russland oder Kasachstan), zu vermeiden?
- Welche Lehren aus internationalen AKW-Neubauprojekten, die häufig den Kostenrahmen sprengen und wirtschaftliche Risiken bergen, fliessen in die Entscheidungsfindung des Bundesrats ein?
Der Entscheid des Bundesrats, das Neubauverbot für AKWs zu hinterfragen, gefährdet die Energiewende, da er die notwendigen turbulenten Veränderungen hin zu einem dezentralen, regenerativen Energiesystem verzögert. Er untergräbt das klare Bekenntnis zum raschen Ausbau erneuerbarer Energien und schafft Unsicherheit in der Energiepolitik. Das verunsichert Investoren und führt zu Verzögerungen beim Ausbau der nötigen Netzinfrastrukturen und Speichertechnologien. Es gefährdet sowohl die Klimaziele der Schweiz als auch die Stabilität und Flexibilität des zukünftigen Energiesystems. Ähnlich wie in anderen Ländern führt das Festhalten an Atomkraft zu einer Verzögerung der Umsetzung von nachhaltigeren, flexibleren Lösungen, die rechtzeitig zur Erreichung der Netto-Null-Ziele im Jahr 2050 erforderlich wären.